Blutdruck, Bluthochdruck, blutdrucksenkende Medikamente und Blutwerte
- Ricokernchen1

- 7. Jan. 2025
- 5 Min. Lesezeit
Blutdruck ist ein essenzieller Indikator für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und ein entscheidender Faktor für die Lebenserwartung. In meiner Arbeit und auch durch persönliche Erfahrungen innerhalb meiner Familie habe ich intensiv mit den Herausforderungen von Bluthochdruck zu tun. Bluthochdruck, auch als "stiller Killer" bekannt, wird oft unterschätzt, da er häufig keine Symptome zeigt, jedoch das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere schwere Erkrankungen erhöht.
Dieser Blog dient, wie alle meine Beiträge, dazu, ein tieferes Verständnis für die Signale des Körpers zu schaffen. Aus dem letzten, für mich sehr lehrreichen Jahr, habe ich einige passende Fallbeispiele die Ihnen verdeutlichen, mit welchen, meist bewussten und logischen Interventionen bereits Erfolge zu verzeichnen sind.
Wie entsteht Bluthochdruck, und warum zeigt er oft keine Symptome?
Welche Rolle spielen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit bei der Regulation des Blutdrucks?
Welche Ursachen gibt es für Bluthochdruck, und wie können wir ihn nachhaltig regulieren?
Mit diesen Fragen verfolge ich das Ziel, Ihnen nicht nur die Ursachen und Zusammenhänge besser zu verdeutlichen, sondern Sie sollen auch motiviert werden, aktiv Maßnahmen für Ihre Gesundheit zu ergreifen.
Was ist Blutdruck? - Eine Differenzierung -
Blutdruck beschreibt die Kraft, mit der das Blut durch die Gefäße gepumpt wird. Er wird in zwei Werten gemessen:
Systolischer Wert: Der Druck, wenn das Herz Blut in die Arterien pumpt.
Diastolischer Wert: Der Druck, wenn das Herz sich entspannt.
Bluthochdruck beginnt bei Werten über 140/90 mmHg, während ein normaler Blutdruck bei etwa 120/80 mmHg liegt. Erhöhter Blutdruck (130-139/85-89 mmHg) ist eine Vorstufe, die ernst genommen werden sollte, um späteren Komplikationen vorzubeugen.
Detaillierte Erklärung: Der systolische Wert ist entscheidend für die Beurteilung des Herzzeitvolumens, während der diastolische Wert die Elastizität der Gefäße widerspiegelt. Chronische Erhöhungen deuten auf eine Gefäßsteifigkeit oder überhöhte Blutvolumina hin.
Ein konkretes Fallbeispiel
Herr M., 55 Jahre alt, berichtet über langanhaltenden Stress im Beruf und hat eine familiäre Vorgeschichte von Hypertonie. Seine Werte liegen bei 145/95 mmHg, und er klagt über gelegentliche Kopfschmerzen. Nach einer Analyse seiner Blutwerte, einer Ernährungsumstellung und gezielter Bewegung konnte er seinen Blutdruck ohne Medikamente senken.
Wie wirken blutdrucksenkende Medikamente?
Blutdrucksenkende Medikamente greifen an verschiedenen Stellen des Herz-Kreislauf-Systems ein. Zudem sind diese Medikamente nicht nebenwirkungsfrei und binden eine erhebliche Menge an wichtigen Mikronährstoffen durch dessen Mangel weitere Nebenwirkungen möglich sind.
Hier eine Übersicht der Hauptgruppen:
ACE-Hemmer: Blockieren ein Enzym, das die Gefäße verengt.
Beta-Blocker: Reduzieren die Herzfrequenz und den Blutdruck.
Diuretika: Fördern die Ausscheidung von überschüssigem Wasser und Salz.
Kalziumkanalblocker: Erweitern die Blutgefäße.
Angiotensin-II-Rezeptorblocker (ARBs): Wirken ähnlich wie ACE-Hemmer, blockieren jedoch direkt den Rezeptor für Angiotensin II.
Ein konkretes Fallbeispiel
Frau S., 62 Jahre alt, nahm über Jahre Beta-Blocker ein. Sie litt jedoch unter Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Gewichtszunahme. Nach einer Eingangs- und Ausgangskontrolle von entscheidenden Blutparametern konnte durch die schrittweise Einführung von Omega-3-Fettsäuren, Magnesium und einer stressreduzierenden Atemtechnik die Dosis unter ärztlicher Begleitung reduziert werden.
Erweiterte Erklärung: ACE-Hemmer verhindern die Bildung von Angiotensin II, das sonst die Gefäße verengt und Aldosteron freisetzt. Diuretika senken den Druck, indem sie das Blutvolumen reduzieren, was jedoch zu Elektrolytverlust führen kann.
Ursachen für einen steigenden Blutdruck
Nähr- und Fremdstoffe
Salz: Hoher Salzkonsum erhöht das Blutvolumen und damit den Blutdruck.
Koffein: Temporärer Anstieg durch Stimulation des Nervensystems.
Alkohol: Regelmäßiger Konsum beeinträchtigt die Gefäßgesundheit.
Nikotin: Verengt die Gefäße und führt zu einem dauerhaften Druckanstieg (die Wasserpfeife ist extrem was den nachhaltig erhöhten Blutdruck betrifft).
Innere Faktoren
Chronischer Stress: Erhöhte Cortisol- und Adrenalinwerte.
Hormonelle Dysbalancen: z. B. erhöhter Aldosteronspiegel.
Genetische Veranlagung: Höhere Empfindlichkeit der Gefäße.
Gewollter Anstieg
Sportliche Betätigung: Kurzzeitige Erhöhung zur Versorgung der Muskeln.
Adaption an Kälte oder Hitze: Fördert die Durchblutung und Anpassungskapazitäten.
Ein Beispiel aus der Praxis
Eine Klientin mit stressbedingtem Bluthochdruck konnte durch eine Kombination aus Sauna, Yoga und Magnesium-Supplementation ihre Werte stabilisieren. Allein durch die marginalen Mängel an Elektrolyten im Zusammenspiel mit einer schlechten Freizeit-Balance hatten diese bereits ihre Zeichen gesetzt.
Hormonelle Einflüsse auf Bluthochdruck
Bluthochdruck kann oft auf hormonelle Dysbalancen zurückgeführt werden, die spezifisch diagnostiziert werden müssen. Sollte bereits ein erhöhter Blutdruck vorhanden sein, könnte dieser durch gezielte Bestimmung der Hormone zuzuordnen sein.
Zu den wichtigsten Hormonen, die untersucht werden sollten, gehören:
Östradiol und Progesteron
Speicheltests ermöglichen die Analyse ihres Verhältnisses, was insbesondere bei Frauen mit Zyklus- oder Wechseljahresbeschwerden entscheidend ist.
Schilddrüsenhormone (TSH, T4, T3)
Bluttests helfen, eine Schilddrüsenunter- oder -überfunktion festzustellen.
Aldosteron und Renin
Der Aldosteron-Renin-Quotient, gemessen durch Bluttests, gibt Hinweise auf einen hormonell bedingten Bluthochdruck.
Adrenalin und Noradrenalin
Eine Analyse über den Urin kann helfen, Stresshormone zu bewerten.
Cortisol (Tagesprofil)
Speicheltests sind hier der Goldstandard, um chronischen Stress oder Dysbalancen in der Nebennierenfunktion zu erkennen.
Histamin und dessen Metaboliten
Urintests können auf Histaminintoleranz hinweisen, die ebenfalls den Blutdruck beeinflussen kann.
Wichtige Blutwerte zur Prävention und Kontrolle
Sie wissen, ich bin begeistert von Blutparametern und empfehle dadurch ganz klar präventives Vorgehen. Hier habe ich einige Werte für Sie, die ein, vielleicht zwei Mal im Jahr zu kontrollieren wären, um frühzeitig eine Änderung des Blutdrucks zu dokumentieren und prämedikatiös Maßnahmen zu ergreifen.
Renin-Angiotensin-System:
Renin, Angiotensin II und Aldosteron
Elektrolyte (immer im Vollblut & Serum):
Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium
Nierenwerte:
Kreatinin, Harnstoff, Cystatin C
Gefäßgesundheit:
Homocystein (immer nüchtern), Lipoprotein (a), hs-CRP
Oxidativer Stress:
Glutathion (Leber), Coenzym Q10, Vitamin C
Blutfettwerte:
Cholesterin ges., HDL, LDL, oxid. LDL, Triglyceride, Omega-3-Index
Ein konkretes Szenario
Bei einem Klienten mit dauerhaft erhöhtem Homocystein konnten durch gezielte B-Vitamin-Supplementation die Werte gesenkt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme reduziert werden.
Die Rolle der Darmgesundheit
Ein oft übersehener Faktor ist die Darmgesundheit. Entzündliche Prozesse im Darm können systemische Entzündungen fördern, die den Blutdruck negativ beeinflussen. Eine gezielte Regulation der Darmflora durch Prä- und Probiotika sowie eine ballaststoffreiche Ernährung kann helfen, den Blutdruck zu stabilisieren.
Medikamente ausschleichen - Ein vorsichtiger Ansatz -
Das Ausschleichen von Medikamenten muss ärztlich überwacht werden.
Bei 4 meiner zu betreuenden "Blutdruck-Personen" stand ich sogar in direkter Verbindung zum jeweiligen Arzt.
Folgende Schritte sind wichtig:
Langsame Reduktion: Verringerung der Dosis über Wochen.
Unterstützung durch Vitalstoffe: Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Coenzym Q10.
Lebensstiländerungen: Salzreduktion, regelmäßige Bewegung, Stressmanagement.
Kontinuierliche Überwachung: Blutdruckprotokoll und regelmäßige Arztbesuche.
Die Ergebnisse waren durchweg positiv und weniger Medikamente bedeutet weniger Fremdeinwirkung auf den Organismus, weniger Nebenwirkungen und mehr Nährstoffe für die biologische Funktionalität.
Effiziente Vitalstoffe und Lebensstilregulation
Magnesium: Entspannt die Gefäße und reguliert den Blutdruck.
Omega-3-Fettsäuren: Wirken antientzündlich und verbessern die Gefäßelastizität.
Vitamin D: Reguliert das Renin-Angiotensin-System.
Kalium: Wirkt natriumantagonistisch und senkt den Blutdruck.
Coenzym Q10: Fördert die Energieproduktion in den Zellen und verbessert die Herzgesundheit.
Auch hier ist nur ein kleiner Auszug an wichtigen blutdruckrelevanten Vitalstoffen. Wichtig ist zu verstehen, dass es immer ein Konglomerat aus Nährstoffen ist, damit alles funktioniert.
Zusätzlich sind regelmäßige Bewegung, Stressbewältigung (z. B. Meditation) und eine antientzündliche Ernährung entscheidend. Beispiele wie die Einbindung von grünen Gemüsesorten oder Walnüssen in die Ernährung zeigten deutliche Verbesserungen bei meinen Klienten.
Ergänzung: Laut Uwe Gröber können blutdrucksenkende Medikamente Vitalstoffe wie Magnesium und Kalium im Körper reduzieren. Daher ist eine gezielte Supplementierung oft notwendig.
Fazit
Blutdrucksenkende Medikamente sind ein wichtiges Instrument zur Behandlung von Hypertonie, doch eine nachhaltige Lösung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Durch die Kombination aus Blutwertkontrolle, gezielter Vitalstoffversorgung und Lebensstiländerungen kann der Blutdruck effektiv reguliert werden. Konkrete Fallbeispiele aus meiner Tätigkeit heraus zeigten, dass eine individuelle Herangehensweise nicht nur die Gesundheit stabilisiert, sondern auch die Lebensqualität verbessert.
Quellen
Gröber, U.: "Medikamente - Nährstoffräuber."
Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention: "Bluthochdruck verstehen."
"Magnesium und Blutdruck" – Zeitschrift für Herz-Kreislauf-Forschung.
"Omega-3-Fettsäuren und Herzgesundheit" – Deutsche Herzstiftung.
"Vitamin D und das Renin-Angiotensin-System" – Endokrinologische Studien.
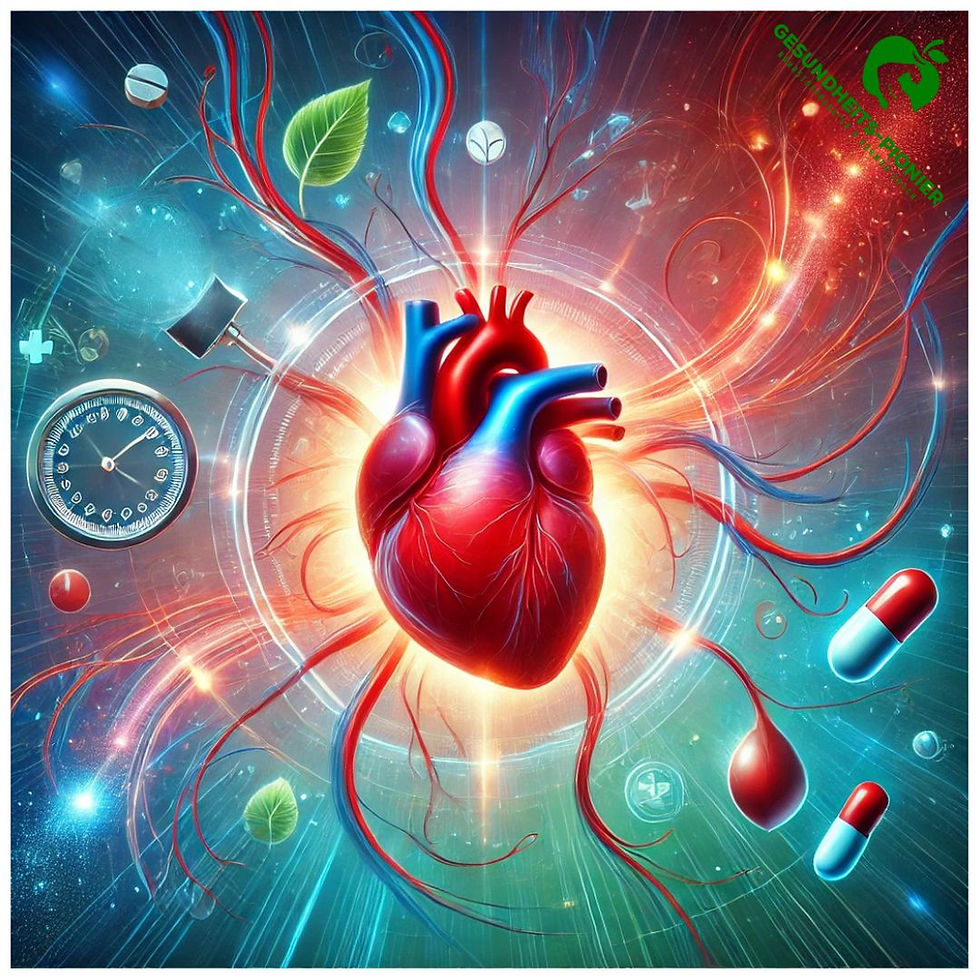




Kommentare